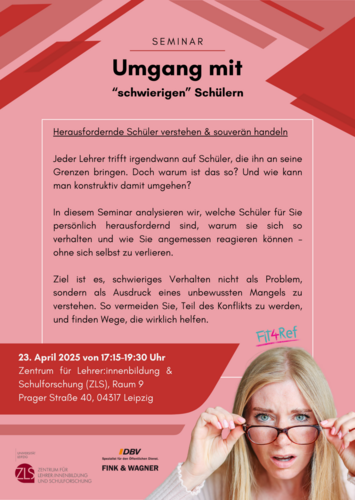Seminarbericht vom 23. April 2025
Wie reagieren, wenn Schüler:innen nicht mitmachen, sich verweigern, provozieren? Rund 60 Lehramtsstudierende nahmen an einem Seminar teil, das den Umgang mit sogenannten „schwierigen“ Schüler:innen auf neue Weise beleuchtete – und dabei weniger fertige Lösungen als vielmehr neue Sichtweisen vermittelte.
Zwischen 17:15 und 19:30 Uhr führte der Konfliktmanager und Projektleiter Eberhard Nassowitz mit klarer Struktur, lebendigen Beispielen und überraschend ehrlichen Einblicken durch den Abend. Im Mittelpunkt: die eigene Haltung und das Verstehen von Verhaltensweisen.
Schwierigkeit ist keine feste Eigenschaft
Gleich zu Beginn machte Nassowitz deutlich: „Sie können buchstäblich aus jedem Menschen einen schwierigen Menschen machen.“ Schwierigkeit sei keine feststehende Eigenschaft, sondern entstehe im Zusammenspiel – oft dann, wenn bei Schüler:innen besonders stark ist, was bei Lehrkräften selbst schwach ausgeprägt ist.
Wie sich dieses Wechselspiel verstehen lässt, wurde im Seminar nicht nur theoretisch, sondern anhand vieler konkreter Beispiele erlebbar – etwa durch die provokante Frage: „Wie könnte man diesen Konflikt jetzt noch verschärfen?“ Dieser Moment regte besonders zum Nachdenken an. Er machte deutlich, wie stark Situationen – bewusst oder unbewusst – durch das eigene Verhalten oder die persönliche Reaktion beeinflusst werden können. Die Erkenntnis, dass das Verhalten von Schüler:innen auch in engem Zusammenhang mit der Haltung und Reaktion der Lehrkraft steht, erwies sich als eine wertvolle Einsicht, die künftig im Unterrichtsalltag berücksichtigt werden kann.
Im ersten Teil des Seminars ging es um persönliche Glaubenssätze – also innere Überzeugungen, die das Verhalten im Schulalltag unbewusst beeinflussen. Sätze wie „Ein:e gute:r Lehrer:in muss immer die Kontrolle behalten“ oder „Wenn ich nachgebe, verliere ich Respekt“ wurden vorgestellt und kritisch hinterfragt.
Die Auseinandersetzung mit diesen Glaubenssätzen erwies sich für viele Teilnehmende als ein zentraler Impuls des Seminars. Besonders der Satz „Wenn ich nachgebe, verliere ich Respekt“ regte zum Nachdenken an. Der damit verbundene Druck, stets stark und kontrolliert auftreten zu müssen, ist vielen vertraut. Deutlich wurde, wie solche Überzeugungen Lehrkräfte in eine Rolle drängen können, die den Handlungsspielraum einschränkt und Konflikte unnötig verschärft. Das Seminar lud dazu ein, die eigene Haltung zu hinterfragen: Woher stammen diese Glaubenssätze? Wann sind sie hilfreich – und wann hinderlich? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen kann dazu beitragen, mehr Flexibilität zuzulassen und starre Prinzipien zugunsten einer gelingenden Beziehung zu Schüler:innen zu überdenken.
Sechs Persönlichkeitsanteile – und was sie in Stresssituationen brauchen
Nassowitz stellte ein Persönlichkeitsmodell vor, das sechs Anteile beschreibt, die in jedem Menschen unterschiedlich stark vorhanden sind. Mit einem Augenzwinkern merkte er an, dass er „einige davon hier im Raum schon wiedererkennt“. Jeder dieser Anteile könne in Stressmomenten „schwierig“ wirken – insbesondere dann, wenn zentrale Bedürfnisse verletzt werden:
• Der sanfte Anteil: höflich, harmoniebedürftig, sensibel – wird in konflikthaften oder groben Situationen schnell verunsichert.
• Der logische Anteil: strukturiert, ordentlich, detailgenau – braucht klare Regeln und kann mit Widersprüchen schwer umgehen.
• Chef:in: verantwortungsbewusst, pflichtorientiert – reagiert empfindlich, wenn Verantwortung nicht ernst genommen wird.
• Der stille Anteil: ruhig, beobachtend – zieht sich zurück, wenn er oder sie zur Konfrontation gezwungen wird.
• Der aktive Anteil: energiegeladen, handelt schnell – braucht Freiräume, um sich auszuprobieren.
• Spaßvogel: bringt Leichtigkeit und Humor – fühlt sich unwohl in dauerhaft ernsten und kontrollierten Kontexten.
Dieses Modell bot eine neue Sprache, um Verhalten im Schulalltag zu verstehen – jenseits gängiger Etiketten wie „disziplinlos“ oder „anstrengend“. Ich fand es besonders spannend, dass jeder dieser Anteile in einem selbst und auch bei den Schüler:innen vorhanden ist. In der Praxis wird es oft schwierig, einen klaren Umgang mit all diesen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen zu finden. Aber die Einsicht, dass jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat, hilft mir, Situationen besser einzuordnen und gezielt zu reagieren.
Mehr Fragen als Antworten – aber genau das war die Stärke
Das Seminar mit Eberhard Nassowitz war eine wertvolle Gelegenheit, den eigenen Blick auf Schüler:innen zu schärfen und neue Strategien für den Umgang mit herausfordernden Situationen zu entwickeln. Es zeigte, dass der Schlüssel zu einem gelingenden Miteinander oft in der Selbstreflexion liegt. Es gibt nicht immer die eine richtige Antwort, aber durch das Bewusstsein über die eigenen Reaktionen und Haltungen lässt sich eine fundierte, offene Herangehensweise entwickeln.
Für mich war dieses Seminar nicht nur eine theoretische Veranstaltung, sondern eine Einladung zur praktischen Auseinandersetzung mit meiner eigenen Haltung als zukünftige Lehrkraft. Es hat mir aufgezeigt, dass ich die Beziehung zu meinen Schüler:innen nicht nur durch Regeln und Strukturen gestalten kann, sondern auch durch ein besseres Verständnis ihrer Persönlichkeiten und Bedürfnisse. In meiner zukünftigen Praxis möchte ich versuchen, die verschiedenen Persönlichkeitsanteile zu erkennen und darauf abgestimmt zu reagieren.
Am Ende des Seminars konnten die Teilnehmenden nach vorn kommen, individuelle Fragen stellen oder Rückmeldungen geben – was den Austausch persönlich und praxisnah machte.